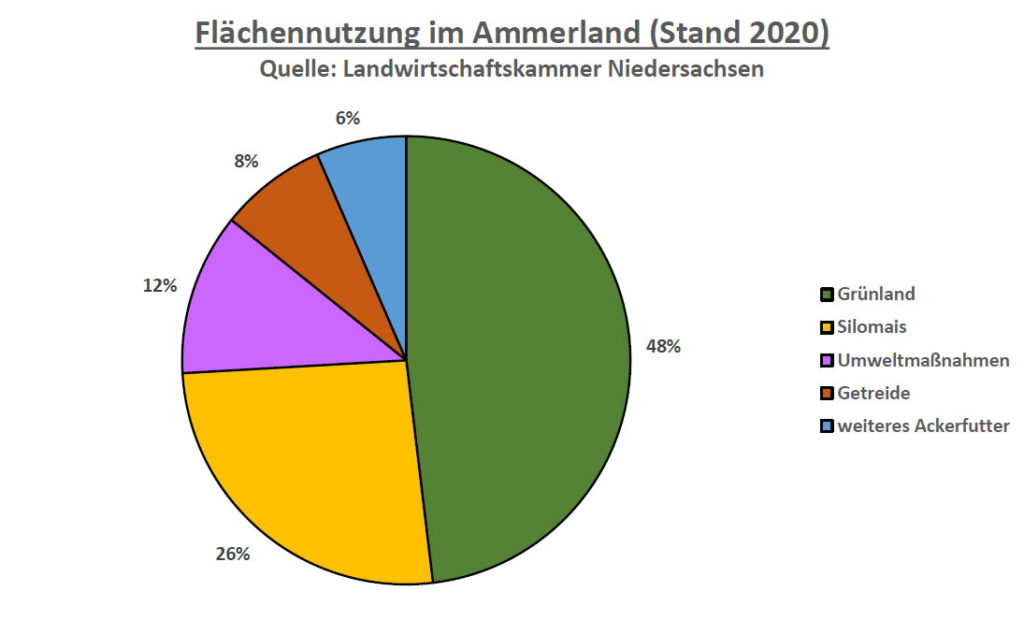Fruchtfolge
Der Begriff Fruchtfolge bezeichnet die Aufeinanderfolge des Anbaus verschiedener Kulturpflanzen auf einer Fläche innerhalb eines Jahres und im Laufe der Jahre. Dabei wird versucht, Kulturpflanzen aus unterschiedlichen Pflanzengattungen anzubauen, da jede Gattung unterschiedliche Krankheiten und Schädlinge aufweist und durch entsprechende Bodenvorbereitung und Saatzeitpunkte oft auch ein anderes Spektrum an Beikräutern fördert. Bei einem Wechsel der Kulturen wird keines dieser Probleme dauerhaft gefördert. Dadurch kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert werden. Im Rahmen von Fruchtfolgen werden im Winter oft Zwischenfrüchte ausgesät. Dies sind meistens Mischungen aus stickstoffbindenden Pflanzen, die die Fläche im Winter begrünen. Sie verwerten Nährstoffe und verhindern so das Auswaschen der Nährstoffe ins Grundwasser, womit sie erheblich zum Grundwasserschutz beitragen. Außerdem schützen sie den Boden vor Erosionen und Witterung. Diese Zwischenfrüchte werden meistens im Frühjahr in den Boden eingearbeitet und erhöhen dann die Bodenfruchtbarkeit. In diesem Betrieb wird auf allen Flächen, die im Herbst abgeerntet sind, eine spezielle Zwischenfrucht-Mischung eingesät.
Ackerbau nach guter fachlicher Praxis
Eine standortgerechte Fruchtfolge ist jedoch nur ein wichtiger Bestandteil der guten fachlichen Praxis im Ackerbau. Sie beinhaltet auch eine zielgerichtete Düngung auf der Grundlage regelmäßiger Bodenuntersuchungen, einer Analyse der im Betrieb anfallenden Wirtschaftsdünger(Gülle und Mist) und natürlich des Nährstoffbedarfs der angebauten Pflanzen. Der Landwirt muss jedes Jahr eine Nährstoffbilanz erstellen, das bedeutet, für jede Fläche Nährstoffzufuhr (z.B. Düngung) und Nährstoffabfuhr (z.B. Ernteerträge) aufzeichnen und nachweisen.
Ein weiterer Bestandteil einer guten fachlichen Praxis ist der integrierte Pflanzenschutz. Er ist Voraussetzung für hohe Erträge und gute Qualität. Er umfasst sämtliche Maßnahmen, die Schadorganismen, Krankheiten und unerwünschte Gräser und Kräuter unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle halten und damit den chemischen Pflanzenschutz auf ein notwendiges Maß reduzieren. Zu diesen Maßnahmen zählen sachgerechte Bodenbearbeitung, richtiger Saattermin und Standort, Auswahl des Saatguts, ausgewogene Düngung und eine angepasste Fruchtfolge.
Auf chemischen Pflanzenschutz greift der Landwirt zurück, wenn trotz aller Maßnahmen die sogenannte Schadschwelle an Kräutern, Gräsern oder Schädlingen überschritten wird. Sie bezeichnet die Befallsstärke bei der der wirtschaftliche Schaden durch Ertragsverlust höher ist, als die Kosten für die Bekämpfung. Der Landwirt muss für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln einen Sachkunde-nachweis haben, das heißt, alle drei Jahre eine Fortbildung absolvieren.

Maßnahmen auf dem Acker am Beispiel Winterweizen
Nach der Ernte der Vorfrucht wird der Boden gepflügt, um die Stoppelreste in den Boden einzuarbeiten. Dann wird mit dem Grubber ein feinkrümeliges Saatbett hergestellt, anschließend im September/Oktober mit der Drillmaschine die Weizenkörner in den Boden gesät. Wenn die Schadschwelle an Gräsern oder Kräutern nach dem Auflaufen der kleinen Pflanzen überschritten wird, erfolgt im Herbst noch die Behandlung mit einem Herbizid (Mittel gegen Beikräuter). Im Frühjahr wachsen die Weizenpflanzen und werden dann mit einem Wachstumsregler behandelt, damit die Pflanze stärker und kürzer bleibt und damit widerstandsfähiger gegen Wind und Witterung ist. Die Ausbringung eines Fungizids (Pilzmittel) ist nur bei einer Pilzerkrankung der Pflanzen erforderlich. Im August wird der Weizen mit einem Mähdrescher geerntet und verkauft.